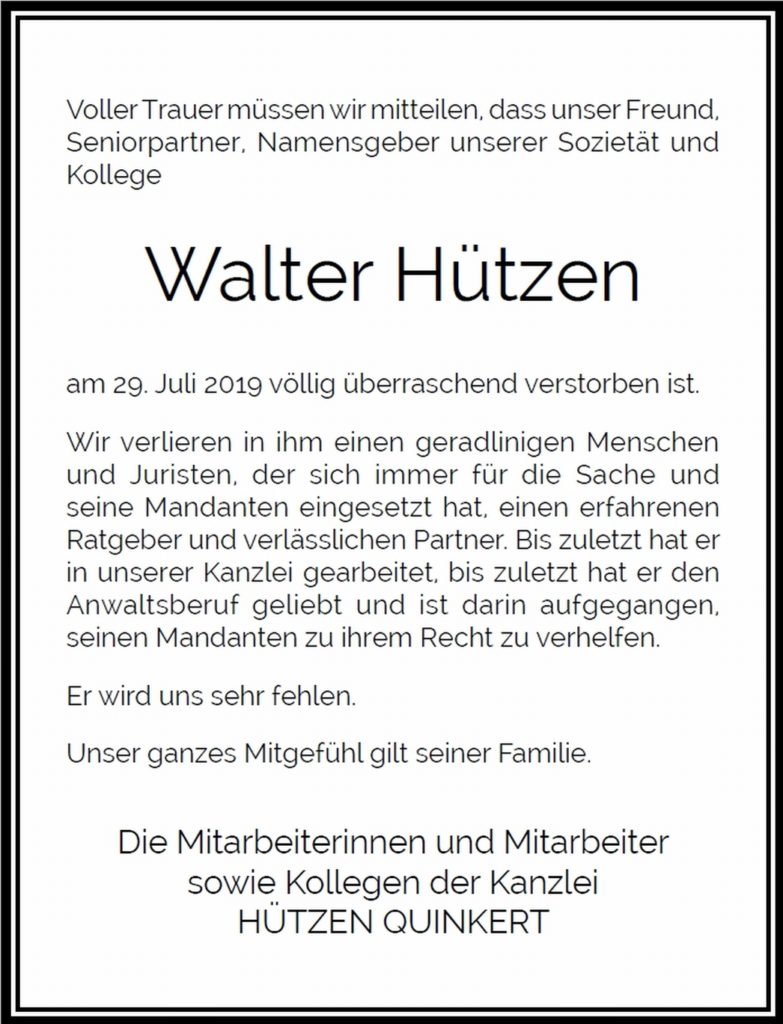Spurensuche nach dem Steuerrecht im StaRUG
WeiterlesenMannheim. Für den 10.11.2020 hatte das Zentrum für Insolvenz und Sanierung an der Universität Mannheim e. V. (ZIS) zu
einem Abendsymposium in hybrider Form zum Thema »Insolvenzrecht und Steuerrecht im Entwurf eines Sanierungsrechtsfortentwicklungsgesetzes
(SanInsFoG)« eingeladen. Das ZIS hatte es sich zur Aufgabe gemacht, im Besonderen die Schnittstelle
zwischen Insolvenz- und Restrukturierungsrecht einerseits und Steuerrecht andererseits zu beleuchten und hierzu
RA/StB Dr. Günter Kahlert, zugleich Vorsitzender des Hamburger Kreis für Sanierungs- und Insolvenzsteuerrecht e. V., sowie
Prof. Dr. Marcel Krumm von der Universität Münster, zugleich Richter am Finanzgericht Münster, eingeladen.
Text: Rechtsanwalt Volker Quinkert, Hützen Quinkert
Dem Gesetzgeber ist durch die EU-Richtlinie über einen präventiven
Restrukturierungsrahmen vom 19.06.2019 aufgegeben
worden, bis Juli 2021 insolvenzvermeidende Sanierungsinstrumente
in Deutschland einzuführen. Ziel soll sein, bestandskräftigen
Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten
eine effektive Restrukturierung zu ermöglichen, ohne ein
förmliches Insolvenzverfahren durchlaufen zu müssen. Nach
den Erwägungsgründen der EU-Richtlinie (RL) soll hierdurch ein
kostengünstiges Verfahren angeboten und einem Schuldner der
Anreiz gegeben werden, frühzeitig Regelungen im Verhältnis
zu seinen Gläubigern anzustreben. Nach Erwägungsgrund 17 RL
sollen hiervon insbesondere auch kleine und mittlere Unternehmen
(sog. KMUs) profitieren. Wegen der Auswirkungen von
Covid-19 betreibt die Bundesregierung das Umsetzungsvorhaben
mit großer Eile; der am 14.10.2020 verabschiedete RegE des
Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetzes
(StaRUG) soll nach dem Willen des Gesetzgebers bereits zum
01.01.2021 in Kraft treten.
Nachdem einen wesentlichen Mangel des deutschen Insolvenzrechts
die fehlende Verzahnung zwischen Insolvenz- und
Steuerrecht darstellt, hatte sich die Veranstaltung zum Ziel gesetzt
zu beleuchten, ob überhaupt und wenn ja in welcher Form
der Gesetzgeber nunmehr eine Abstimmung zwischen dem Restrukturierungsrecht
und dem Insolvenzrecht vorsieht. Hierzu
referierte zunächst Günther Kahlert mit dem Thema »Der Entwurf
eines SanInsFoG: Perspektiven für eine kohärente und praxisgerechte
Verzahnung von Steuerrecht und Insolvenzrecht«.
Um einen Zugang zur Beantwortung der steuerrechtlichen Fragen
zu finden, sind zunächst einmal die unterschiedlichen Verfahrenszugangsvoraussetzungen
darzulegen. Von den Insolvenzgründen
der §§ 17 bis 19 InsO ist nach § 31 Abs. 1 StaRUG nur die
drohende Zahlungsunfähigkeit i. S. v. § 18 Abs. 2 InsO maßgeblich.
In diesem Fall bietet das Gesetz die einzelnen, in § 31 Abs. 2
StaRUG genannten Instrumente bis hin zur gerichtlichen Bestätigung
eines Restrukturierungsplans. Daneben sieht das Gesetz das
(schwächere) Mittel einer Sanierungsmoderation bei bloßen wirtschaftlichen
und finanziellen Schwierigkeiten vor (§ 100 Abs. 2
Nr. 2 StaRUG). Während das Restrukturierungsverfahren nach § 31
StaRUG für die Gläubiger bindende Regelungen vorsieht, sind
demgegenüber im Rahmen einer Sanierungsmoderation nur einvernehmliche
Regelungen möglich.
Wie Kahlert nachfolgend herausgearbeitet hat, haben die
von den Regelungen der InsO abweichenden Ansätze unmittelbare
Auswirkungen auf die steuerlichen Folgen eines solchen
Verfahrens. Im Restrukturierungsverfahren erfolge keine Berichtigung
der Umsatzsteuer und der Vorsteuer. Denn es fehle
an der Uneinbringlichkeit, die erst mit eingetretener Zahlungsunfähigkeit
gegeben ist. Die nur drohende Zahlungsunfähigkeit
bewirke keine ertragswirksame Auflösung von Verbindlichkeiten.
Denn es stehe noch nicht endgültig fest, dass die Verbindlichkeit
entfällt. Umsatzsteuerliche oder ertragsteuerliche
Organschaften blieben im Restrukturierungsverfahren bestehen
und auch Steuerfestsetzungs- und Rechtsbehelfsverfahren würden
durch ein Verfahren nach dem StaRUG nicht unterbrochen.
Zusammengefasst: Solange ein Restrukturierungsplan nicht
durch Beschluss nach § 67 Abs. 1 Satz 1 StaRUG bestätigt ist,
ergeben sich steuerrechtlich keine wesentlichen Folgen.
Dies ändert sich erst mit der gerichtlichen Bestätigung. § 74
Abs. 1 StaRUG bestimme insoweit, dass die im gestaltenden Teil
des Restrukturierungsplans festgelegten Wirkungen mit Bestätigung
eintreten. Folge ist nach Kahlert, dass der Schuldner erst
zu diesem Zeitpunkt von einer Haftung gegenüber seinem Gläubiger
befreit wird. Deshalb sei eine Steuer auf den Ertrag nicht
im Plan anzusetzen und der Ertrag, der sich aus der Planumsetzung
ergibt, sei unter den Voraussetzungen der §§ 3 a, 3 c Abs. 4
EStG, § 7 b GewStG steuerfrei zu stellen. Nicht erfasst vom Plan
würden weiterhin ertragsteuerliche Konsequenzen aus der Auflösung
stiller Reserven sowie der Berichtigung der Vorsteuer
aufgrund eines Forderungsverzichts der Gläubiger, wobei Kahlert
hier die Frage in den Raum stellte, inwieweit dieses Problem
durch eine vorherige Umwandlung bestehender Verbindlichkeiten
in Darlehen vermieden werden kann. Auf jeden Fall sei es
dringend geboten, das zuständige Finanzamt zu den steuerlichen
Folgen des Restrukturierungsplans um eine verbindliche
Auskunft zu bitten.
Besonders in steuerrechtlicher Hinsicht sind dabei die beschränkten
Wirkungen des Restrukturierungsplans zu berücksichtigen,
die sich aus § 77 Abs. 1 StaRUG ergeben. Danach unterliegen
streitige Restrukturierungsforderungen den Regelungen des
Restrukturierungsplans nur in der im Plan vorgesehenen Höhe,
nicht aber über diesen Betrag hinaus. Dies bedeutet laut Kahlert:
Werden über die Wertansätze für Zahlungsansprüche des Fiskus im
Restrukturierungsplan später höhere Forderungen geltend gemacht,
so werden diese von den Wirkungen des Plans nicht erfasst.
Diese Ansprüche können gegenüber dem im Plan überschießenden
Betrag vollumfänglich gegen den Schuldner geltend
gemacht werden. Dogmatisch sieht Kahlert dies damit begründet,
dass ein Feststellungsverfahren, wie es etwa die InsO kennt, im
StaRUG-Verfahren nicht vorgesehen ist.
Aus Sicht der Finanzverwaltung nichts Neues
Anschließend beschäftigte sich Krumm mit dem geplanten
Restrukturierungsverfahren unter dem Aspekt »Insolvenz im
Steuerrecht im Entwurf eines SanInsFoG aus Sicht des Steuergläubigers
«. Zentrales Thema war das Verhältnis zwischen Massesicherungspflicht
und Steuerzahlungspflicht. Krumm verwies
auf die schon etwa 15 Jahre alte Rechtsprechung des BGH, wonach
Steuerzahlungen grundsätzlich mit der Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns vereinbar seien, weil die Nichtzahlung
mit Bußgeld bedroht und mit Haftungsrisiken für den Geschäftsleiter
verbunden seien. Daran anschließend habe der 7. Senat
des BFH geurteilt, dass nach seiner Auffassung in der Insolvenz
ein Vorrang der Steuerzahlungsfrist vor der Massesicherungspflicht
besteht. Daraus folgert aus Sicht der Finanzverwaltung,
dass die Steuerabführungspflicht auch nach Insolvenzantragstellung
fortbesteht. Dies gelte erst für das vorgelagerte Restrukturierungsverfahren.
Wäre etwas anderes gewollt gewesen,
dann wäre es Aufgabe des Gesetzgebers gewesen, klar und deutlich
zu regeln, dass die vom BFH aufgestellten Grundsätze nicht
weiter fortgelten sollen. Dies hat der Gesetzgeber nicht getan.
Damit bestehe keine Veranlassung, von der Rechtsprechung des
BFH abzuweichen. Ergebnis: Aus Sicht der Finanzverwaltung
gibt es nichts Neues.
Um diesen Themenkreis drehte sich dann auch im Wesentlichen
die nachfolgende Diskussion, die gleichzeitig angesichts
der hochwissenschaftlichen Erörterungen eine Schwäche des
Formats als Hybridveranstaltung offenbarte. Obwohl das Symposium
mit rd. 200 Teilnehmern – davon allerdings der weitaus
größte Anteil virtuell – gut besucht war, reduzierte sich die
nachfolgende, sehr interessante Diskussion im Wesentlichen auf
einen Austausch der Meinungen von Kahlert, Krumm und Moderator
Prof. Dr. Georg Bitter. Hinsichtlich der von Krumm beschriebenen
Pflichtenkollision des Geschäftsleiters forderte
Kahlert vehement eine Entscheidung des Gesetzgebers. Es könne
nicht weiter so sein, dass man den Geschäftsleiter, der
schließlich das Unternehmen nach der Restrukturierung auch
weiterführen solle, »im Regen stehen« lasse. Dieses schon aus
der InsO bekannte Problem werde auch im StaRUG nicht geregelt.
Hier sei der Gesetzgeber gefordert. Krumm sah dieses Thema
aus Sicht der Finanzverwaltung dagegen gelassen; die Geschäftsleiter
hätten jederzeit die Möglichkeit, sich an der
Rechtsprechung von BGH und BFH zu orientieren. Dem hielt
Kahlert entgegen, dass die steuerlichen Folgen häufig zu dem
Zeitpunkt der Fälligkeit von Steuern noch gar nicht absehbar
seien. Dies gelte im Übrigen auch für vorläufige Insolvenz- und
Eigenverwaltungsverfahren. Auch dort bestehe latent das Risiko
einer Haftung der handelnden Personen. Bis zu einer Gesetzesänderung,
so Krumm, sei es aber zwingend geboten, die bisher
aufgestellten Rechtsgrundsätze weiter anzuwenden. Dahinter
stehe letztlich auch der Gedanke, dass der Geschäftsleiter bei
eingetretener Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung letztlich
verpflichtet ist, Insolvenzantrag zu stellen. Dies beinhalte
umgekehrt seine Verpflichtung, die fällig werdenden Steuern
abzuführen. Tritt die Insolvenzreife ein, so sei der Geschäftsführer
gesetzlich verpflichtet, einen nach der Insolvenzordnung
zulässigen Antrag zu stellen. Es könne letztlich nicht sein, dass
diese Antragspflicht dadurch unterlaufen wird, dass die Steuer-
abführungspflicht im Restrukturierungsverfahren ausgesetzt
wird. Es erscheine richtig, dass derjenige, der eine Insolvenz
verschleppt, an dieser Stelle nicht geschützt wird. Ergänzend
verwies Krumm darauf, dass nach Auffassung der Finanzverwaltung
die Steuerzahlungspflicht auch im Rahmen der vorläufigen
Eigenverwaltung gilt und nicht von der Massesicherungspflicht
verdrängt wird. Daran wiederum seien Haftungsfolgen geknüpft.
Hier gehe die Finanzverwaltung inzwischen regelmäßig davon
aus, dass die Haftung für nicht abgeführte Steuern auch den
vorläufigen Sachwalter trifft, soweit er – dies sei entscheidend
– die Kassenführung übernommen hat.
§ 55 Abs. 4 InsO-RefE: Finanzverwaltung
widersetzt sich
Auch Bitter vertrat insoweit die Auffassung, dass das Problem
der Pflichtenkollisionen für die Geschäftsleiter nicht gelöst
und eine Regelung durch den Gesetzgeber dringend notwendig
sei. Anzufügen ist, dass die noch im RefE vorgesehene Erweiterung
der Anwendbarkeit von § 55 Abs. 4 InsO auf Verfahren der
vorläufigen Eigenverwaltung, die auch von maßgeblichen Verbänden
gefordert wird (vgl. z. B. das Eckpunktepapier Steuern
des VID) im RegE nicht mehr enthalten ist. Nach Krumm habe
sich die Finanzverwaltung der im RefE vorgesehenen Neuregelung
wegen des fehlenden Bezugs zu Ertragsteuern widersetzt.
Kahlert verwies dazu auf die Sorge der Finanzverwaltung, stille
Reserven ertragsteuerlich nicht als Masseverbindlichkeit erfassen
zu können. Bitter wies zusätzlich auf die gesetzgeberische
Besonderheit hin, dass die Bundesregierung ein zustimmungsbedürftiges
Gesetz auf jeden Fall vermeiden wolle, um sicherzustellen,
dass das Gesetz auch tatsächlich am 01.01.2021 in
Kraft treten kann, wobei Krumm Zweifel äußerte, ob die Regelung
tatsächlich zustimmungsbedürftig ist.
Nach Kahlert setzt die fehlende Anwendbarkeit von § 55
Abs. 4 InsO auf Fälle der vorläufigen Eigenverwaltung weiterhin
Fehlanreize. Die Praxis zeige, dass eine vergleichsweise hohe
Anzahl von Verfahren als vorläufige Eigenverwaltungsverfahren
begonnen werden, obwohl diese tatsächlich für eine solche Verfahrensart
gar nicht geeignet sind. Die steuerliche Bevorzugung
der Eigenverwaltung sei für ihn an dieser Stelle weiterhin nicht
nachzuvollziehen. Bitter warf ergänzend die Frage auf, ob die
z. T. deutliche Verlängerung vorläufiger Eigenverwaltungsverfahren
durch revolvierende Absprachen nicht möglicherweise
einen Gestaltungsmissbrauch darstellen könnte. Dies bezweifelte
Krumm. § 42 AO scheine aus seiner Sicht nicht einschlägig zu
sein, weil § 55 Abs. 4 InsO keine steuerrechtliche Regelung sei.
Schließlich wurde ausgiebig erörtert, welche Folgen sich aus
§ 77 Abs. 1 StaRUG ergeben, wo bestimmt ist, dass der Restrukturierungsplan
auf streitige Forderungen nicht anwendbar ist.
Krumm ging der Frage nach, welche Folgen die falsche Bezifferung
der Steueransprüche im Plan hätte. Reicht es aus, Sachverhalte zu
benennen, um etwa Nachforderungen im Rahmen von Betriebsprüfungen
auszuschließen? Damit wäre ein unkalkulierbares Risiko
verbunden, wenngleich § 77 Abs. 1 StaRUG ausdrücklich regle,
dass die Restrukturierungsforderungen nicht über den Betrag hinaus
berücksichtigt und vom Plan erfasst werden, der im Plan
auch tatsächlich genannt wird. Hier warf Prof. Dr. Dominik Skauradszun
in die Diskussion ein, dass der Schuldner zwar die Möglichkeit
habe, konkrete Beträge zu benennen. Der Wortlaut des
§ 77 Abs. 1 StaRUG sei allerdings eindeutig: Darüber hinausgehende
Forderungen, insbesondere zusätzliche Steuern, könnten
weiter geltend gemacht werden. Dies sei ein erhebliches Risiko für
den Planersteller und das zu sanierende Unternehmen. Skauradszun
plädierte deshalb für die Möglichkeit, auch zukünftige
Forderungen zu regeln. Dies solle der Gesetzgeber nochmals
prüfen. Bitter verwies dagegen auf das Risiko eines Gestaltungsmissbrauchs,
wenn nicht eindeutig definiert werde, was Gegenstand
der Wirkungen des Restrukturierungsplans sein soll. Krumm
erinnerte erneut daran, dass die tatsächliche Höhe der festzusetzenden
Steuerforderungen häufig erst nach einer Betriebsprüfung
feststeht und es nicht sein kann, dass dem Fiskus die Erhebung
solcher Steuern unmöglich gemacht wird. Darauf entgegnete
Kahlert, dass in solchen Fällen dann letztlich nur der Weg zum
Insolvenzgericht bleibe; das StaRUG sei einfach nicht das richtige
Verfahren für streitige Forderungen.
Letztlich bestand Einigkeit darüber, dass den Geschäftsleitern
weiterhin erhebliche Haftungsrisiken aufgebürdet werden.
Außerdem wurde der hohe Zeitdruck, unter dem das Gesetz verabschiedet
werden soll, kritisiert. Wesentliche gesetzgeberische
Entscheidungen blieben ausgeklammert, so vor allem für
die Auflösung der Pflichtenkollision des Geschäftsleiters und
die Neuregelung von § 55 Abs. 4 InsO. Außerdem müsse bezweifelt
werden, dass angesichts der Komplexität der jetzt vorgesehenen
Regelung das Verfahren tatsächlich für kleine und mittlere
Unternehmen geeignet sei. Diese dürften häufig schon
nicht in der Lage sein, ein solches Verfahren zu finanzieren.
Zudem hätten gerade große Verfahren in jüngster Vergangenheit,
die im Rahmen der Eigenverwaltung innerhalb weniger
Monate erfolgreich abgeschlossen werden konnten, verdeutlicht,
dass das vorhandene System funktioniert. Deshalb sei es
letztlich auch nicht verständlich, warum der deutsche Gesetzgeber
nicht für eine vertiefende Diskussion die vom Richtliniengeber
gewährte zweijährige Frist ausschöpfen will. «